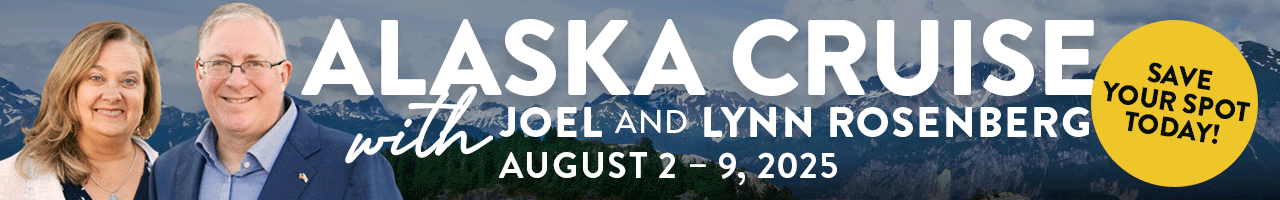Libyen hat sein eigenes Atomprogramm abgebaut - ein brauchbares Modell für den Iran?
Einblicke in das bevorzugte Szenario von Premierminister Netanjahu

Während seines jüngsten Besuchs in Washington, DC, zu Gesprächen mit Präsident Donald Trump, brachte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu mehrmals die "libysche Option" im Umgang mit dem iranischen Atomprogramm zur Sprache.
In einer Fragerunde nach dem Treffen sagte Netanjahu, dass sowohl Israel als auch die USA sich einig seien, dass der Iran keine Atomwaffen besitzen dürfe.
„Das kann auf diplomatischem Weg geschehen – vollständig – so wie es in Libyen gemacht wurde. Ich denke, das wäre eine gute Lösung“, sagte er in Bezug auf das Abkommen von 2003, in dem Libyen sich freiwillig bereit erklärte, sein Atomwaffenprogramm vollständig abzubauen.
„Aber was auch immer geschieht, wir müssen sicherstellen, dass der Iran keine Atomwaffen hat“.
In einer Erklärung auf Hebräisch, die kurz vor seiner Abreise aus den USA veröffentlicht wurde, bezog sich Netanjahu erneut auf das Beispiel Libyens und sagte, ein diplomatisches Abkommen sei möglich – „aber nur, wenn es ein Abkommen im libyschen Stil ist – bei dem man hineingeht, die Anlagen zerstört, alle Geräte unter amerikanischer Aufsicht und Ausführung demontiert.“
"Die zweite Möglichkeit ist, dass es nicht zustande kommt. In diesem Fall werden die Gespräche einfach abgewürgt, und die andere Option ist militärisch", erklärte Netanjahu. Auch Trump verwies auf die Möglichkeit einer militärischen Option und erklärte, dass es für den Iran besser wäre, einem Abkommen zuzustimmen.
„Ich denke, wenn die Gespräche mit dem Iran nicht erfolgreich sind, wird der Iran in großer Gefahr sein – und ich sage das nur ungern, aber sie dürfen keine Atomwaffen haben. Das ist keine komplizierte Formel“, sagte Trump.
Worum ging es bei dem Atomabkommen mit Libyen?
Das Land Libyen, unter der Führung des Diktators Muammar al-Gaddafi, verfolgte seit mindestens Ende der 1970er Jahre heimlich ein Atomwaffenprogramm.
Die Technologie und das Material für das Programm hatte das Land größtenteils illegal erworben, da der Verkauf solcher Technologie aufgrund der Angst, ein Terrorstaat könnte Atomwaffen erlangen, stark eingeschränkt war. Libyen galt als eines der isoliertesten und unberechenbarsten Länder der Welt – vergleichbar mit Nordkorea.
Nach dem Einmarsch im Irak im März 2003 – Teil des umfassenderen „Kriegs gegen den Terror“ nach den Anschlägen vom 11. September 2001 – verfolgte Präsident George W. Bush eine Politik zur Begrenzung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen (MVW). Mit Unterstützung des britischen Premierministers Tony Blair wählte Bush Libyen als Testfall für diplomatische Lösungen anstelle von Sanktionen oder militärischem Eingreifen.
Die drei Länder nahmen an diskreten Verhandlungen teil, um Libyen zur freiwilligen Aufgabe seines Atomwaffenprogramms zu bewegen.
Im Dezember 2003 gaben die Länder bekannt, dass ein Abkommen erreicht worden sei, in dem sich Libyen verpflichtete, sein Atomwaffenprogramm vollständig abzubauen – einschließlich der Zerstörung oder Übergabe aller dazugehörigen Infrastrukturen und Materialien wie Zentrifugen, Urananreicherungseinrichtungen und anderer Ausrüstung.
Zusätzlich verpflichtete sich Libyen, alle weiteren MVW-Programme zu beenden, einschließlich chemischer und biologischer Forschungsanlagen. Zur Überwachung des Abkommens gewährte Libyen der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) sowie amerikanischen und britischen Inspektoren Zugang.
Wegen seiner Unterstützung des Terrors und seiner MVW-Ambitionen war Libyen mit lähmenden Sanktionen belegt worden, die die Wirtschaft des Landes schwer belasteten. Im Rahmen der Verhandlungen erklärten sich die USA und Großbritannien bereit, die Sanktionen aufzuheben und Libyen wieder den Verkauf von Erdöl auf dem Weltmarkt zu ermöglichen.
Westliche Ölkonzerne wie BP und Shell durften wieder in die libysche Erdölwirtschaft investieren, was dringend benötigte Finanzmittel ins Land brachte.
Zudem nahmen die USA und Großbritannien ihre diplomatischen Beziehungen zu Libyen wieder vollständig auf. Die USA eröffneten ihre Botschaft in Tripolis wieder, und beide Länder strichen Libyen von der Liste staatlicher Terrorunterstützer.
Der britische Premierminister Tony Blair besuchte Libyen 2004, was die vollständige Wiederherstellung der Beziehungen symbolisierte.
Nach der Unterzeichnung des Abkommens setzte Libyen dessen Bedingungen zügig um. Bereits wenige Monate nach der Ankündigung waren die meisten Nuklearanlagen abgebaut und zur Vernichtung und Entsorgung in die USA gebracht worden.
Die Initiative zum Abbau des Atomwaffenprogramms ging von Gaddafi selbst aus, der nach dem Sturz des irakischen Regimes und Saddam Husseins offenbar ein ähnliches Schicksal fürchtete. Um den Status als Paria-Staat zu beenden, entschied er sich, das Programm aufzugeben.
Auch wenn Gaddafi schließlich im Zuge des Arabischen Frühlings gestürzt und getötet wurde, galt das Abkommen als Erfolg diplomatischer Bemühungen gegenüber militärischer Gewalt.
Obwohl es Parallelen zwischen Libyen und dem Iran gibt – beide galten als Terrorunterstützer und waren über Jahre hinweg mit schweren Sanktionen belegt –, gibt es auch wesentliche Unterschiede.
Anders als Libyen, das von einem Einzelnen geführt wurde, der heimlich verhandeln konnte, ist die Machtstruktur im Iran komplexer.
Die Islamische Republik gründet ihre Identität auf der Feindschaft gegenüber dem Westen – insbesondere gegenüber den USA und Israel. Es ist daher fraglich, ob das Regime einem Abkommen zustimmen würde, das von vielen als Kapitulation gegenüber diesen beiden Feinden angesehen würde.
Die öffentliche Ankündigung der Gespräche durch Trump beseitigt zudem den geheimen Rahmen, der dem Iran Raum für Zugeständnisse hätte bieten können.
Durch die öffentliche Bekanntgabe der Gespräche hat Trump auch den Druck auf den Iran erhöht, nicht zu viele Zugeständnisse zu machen.

Die Mitarbeiter von All Israel News sind ein Team von Journalisten in Israel