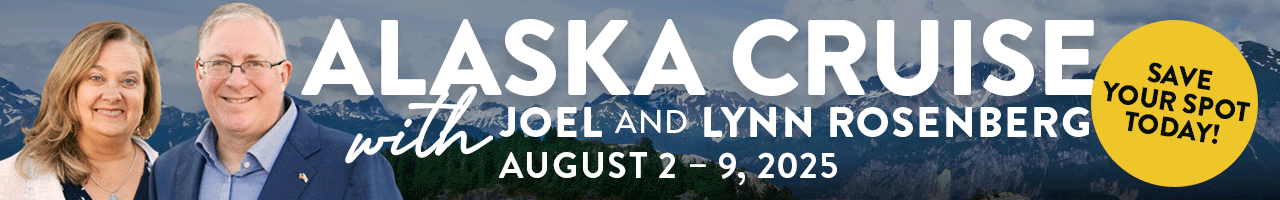Heilige Worte mit uralter Herkunft – Über 30.000 nehmen am priesterlichen Segen an der Klagemauer teil

In der Tora, unmittelbar nach der Beschreibung des asketischen Lebens derer, die das Nasiräer-Gelübde ablegen (4. Mose 6), spricht der Herr zu Mose: „Rede zu Aaron und seinen Söhnen und sprich: So sollt ihr die Kinder Israels segnen; sprecht zu ihnen…“ Darauf folgt der berühmte „Priestersegen“, auf Hebräisch „Birkat haCohanim“. Er lautet:
„Der HERR segne dich und behüte dich! Der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig! Der HERR erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden!“ (4. Mose 6,24–26).
Es ist ein schöner, herzerwärmender Segen, doch manche Ausdrücke mögen modernen westlichen Ohren etwas fremd vorkommen. Was bedeutet es zum Beispiel, wenn Gottes Angesicht über uns leuchtet? Oder wenn Er sein Angesicht erhebt? Je mehr wir über diese Begriffe und ihr Verständnis in biblischer Zeit wissen, desto kraftvoller wird dieser Segen.
Doch schauen wir uns zunächst die Priester selbst an. Ursprünglich wollte Gott, dass die Erstgeborenen jeder Familie beiseitegestellt werden, um ihm zu dienen (2. Mose 13,1), aber nachdem der Stamm Levi nach dem Vorfall mit dem goldenen Kalb in 3. Mose 32 die Ehre des Herrn so eifrig verteidigt hatte, beschloss Gott, eine Änderung vorzunehmen.
In 4. Mose 8 – nur wenige Kapitel nach dem Priestersegen – erklärt Gott es ausführlich. Zusammengefasst sagt Er: „Und ich habe die Leviten genommen anstelle aller Erstgeburt unter den Kindern Israels“ (Vers 18). Und von da an war das Gesetz geändert. Mose und Aaron stammten beide aus dem Stamm Levi, und der ganze Stamm wurde zum Dienst für den Herrn berufen.
Die Priester Gottes – auf Hebräisch „Kohanim“ – sollten im Tempel dienen. Zwar waren alle Kohanim Leviten, aber nicht alle Leviten waren Priester.
Die Priester Gottes hatten eine sehr wichtige Aufgabe, indem sie dem Volk Israel bei der Anbetung Gottes halfen, und es war viel Arbeit damit verbunden, für die Opfer und den ordnungsgemäßen Unterhalt der Stiftshütte und später des Tempels zu sorgen. Vielleicht ist Ihnen auch der Familienname „Cohen“ schon begegnet und die Verbindung - in der Tat das Gen - setzt sich in der priesterlichen Linie der Cohanim (Plural von Cohan) bis zum heutigen Tag fort.
Dr. Skorecki, ein Nephrologe und Spitzenforscher an der Universität Toronto und dem Rambam-Technion Medical Center in Haifa, war an bahnbrechenden Entwicklungen in der molekularen Genetik beteiligt. Aufgrund seines Interesses an der Anwendung von DNA-Analysen auf historische und ethnische Studien, stellte er die Hypothese auf, dass es genetische Marker geben könnte, die auf einen gemeinsamen Vorfahren zurückgehen – auf Aaron, den ersten Kohen.
Dr. Skorecki fragte sich, ob Aarons Linie seit dem Berg Sinai bewahrt worden sein könnte – und noch wichtiger: ob sich eine solche Behauptung wissenschaftlich überprüfen ließe. Zusammen mit dem führenden Molekulargenetiker und Pionier der Y-Chromosomen-Forschung, Professor Michael Hammer, begann er mit der Untersuchung. Ihre erste Studie wurde am 2. Januar 1997 in der britischen Wissenschaftszeitschrift Nature veröffentlicht.
Nach der Analyse der DNA von 188 jüdischen Männern stellten die Forscher fest, dass die Y-Chromosomen-Marker der Kohanim und Nicht-Kohanim tatsächlich signifikante Unterschiede aufwiesen. Ein genetischer Marker im Besonderen (YAP-) wurde bei 98,5 Prozent der Kohanim festgestellt. In einer weiteren Studie wurden sechs chromosomale Marker bei 97 von 106 getesteten Kohanim gefunden – bekannt als der „Cohen Modal Haplotype“ (CMH), das genetische Standardmerkmal der jüdischen Priesterfamilie.
Die Bibel betont mehrfach (siehe 2. Mose 29,9; 2. Mose 40,15; 4. Mose 25,13), dass das Priestertum für immer bestehen werde. Und es scheint, dass trotz des historischen Verschwindens ganzer Stämme die priesterliche Linie bis heute nachweislich identifiziert werden kann.
In biblischer Zeit sprachen die Kohanim täglich den priesterlichen Segen, so wie es auch heute noch in Jerusalem geschieht. Der Segen wird bei jedem Synagogengottesdienst und auch bei den Festtagen erteilt, wenn Zehntausende zur Klagemauer strömen, um den Segen zu empfangen.
Man nennt die Zeremonie manchmal auch „Nesi’at Kapayim“ – das Erheben der Hände. Dabei formen die Priester mit ihren Fingern den hebräischen Buchstaben „Schin“ (ש), so wie es Spock in Star Trek tat (Leonard Nimoy war jüdisch und hatte es in der Synagoge gesehen). Der Buchstabe Schin steht für „Adonai“, den Namen des Herrn. Auffällig ist, dass der Name des Herrn dreimal erscheint, so wie auch im Sch’ma-Gebet: „Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer…“ Sein Name wird also dreimal wiederholt, was auf die Dreifaltigkeit Gottes hinweist.
Ungewöhnlich ist, dass der Segen direkt und in der zweiten Person gesprochen wird und nicht in der ersten Person Plural („dich“ statt „uns“), was seine Wirkung auf die Zuhörer noch verstärkt. Es ist Tradition, während des Segens den Priester nicht anzuschauen, sondern sich nur darauf zu konzentrieren, den Segen zu empfangen. Die Worte sind von so tiefer Güte, dass der priesterliche Segen als „göttliche Umarmung“ bezeichnet wird!
„Der Herr segne dich und behüte dich“ spricht von Gottes großer Güte, Versorgung und Schutz. Der nächste Satz entfaltet seine Bedeutung im Kontext des antiken Königtums: „Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig“ erinnert an Sprüche 16,15: „Wenn das Angesicht des Königs leuchtet, bedeutet es Leben, und seine Gunst ist wie eine Wolke des Spätregens.“
Könige hatten zur damaligen Zeit Macht über Leben und Tod, und ihre Gunst wurde als gewaltiger Segen verstanden – wie lebensnotwendiger Regen. Das „Leuchten“ im Gesicht des Königs deutete auf die Gunst dessen hin, der die Macht hatte, das Schicksal zu bestimmen.
Der nächste Satz, „Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich“, wird klarer, wenn wir ihn mit anderen biblischen Ausdrücken vergleichen. In 1. Mose 4 sehen wir im Bericht von Kain und Abel, dass ein „gesenktes Angesicht“ einen zutiefst negativen Zustand anzeigt: „Und der HERR sprach zu Kain: Warum bist du so wütend, und warum senkt sich dein Angesicht?“ Das erhobene Angesicht steht somit im Gegensatz dazu und spricht von Gottes Wohlwollen und positiver Zuwendung zu seinem Volk.
Schließlich hat der Ausdruck „und gebe dir Frieden“ ein großes Gewicht im Sinne des Bundes. Nehmen wir noch einmal ein Beispiel aus dem Gegenteil in der Heiligen Schrift, so können wir die Bedeutung besser erfassen, wenn wir die Folgerung betrachten. Dem Propheten Jeremia wurde gesagt, er solle keine Zeit damit verschwenden, um die Menschen seiner Zeit zu trauern:
„Du sollst in kein Trauerhaus gehen und zu keiner Totenklage und sollst ihnen auch kein Beileid bezeugen; denn ich habe meinen Frieden von diesem Volk weggenommen“, spricht der Herr, „die Gnade und das Erbarmen“ (Jeremia 16,5). Hier sehen wir, wie Gott seinen Frieden und seine Freundschaft entzieht – der Priestersegen hingegen ruft das Gegenteil hervor. Er nimmt den Frieden nicht weg, sondern schenkt ihn. Gottes Freundlichkeit und Barmherzigkeit sind Teil des Pakets. Der Abschnitt in 4. Mose 6 endet mit der Anweisung Gottes: „Und so sollen sie meinen Namen auf die Kinder Israels legen, und ich will sie segnen.“ Was für eine mächtige Verheißung.
Während der Covid-Pandemie erlangte der Priestersegen weltweite Bedeutung, als er vertont wurde und viral ging. Es wurden viele verschiedene Versionen in unterschiedlichen Sprachen erstellt, darunter auch eine aus dem Nahen Osten, in der Worte des Friedens und des Segens in Sprachen aus der gesamten Region gesungen werden, und das in einer Zeit, in der dies dringend nötig ist.

Jo Elizabeth interessiert sich sehr für Politik und kulturelle Entwicklungen. Sie hat Sozialpolitik studiert und einen Master in Jüdischer Philosophie an der Universität Haifa erworben, schreibt aber am liebsten über die Bibel und ihr Hauptthema, den Gott Israels. Als Schriftstellerin verbringt Jo ihre Zeit zwischen dem Vereinigten Königreich und Jerusalem, Israel.